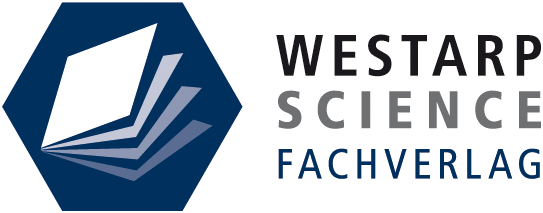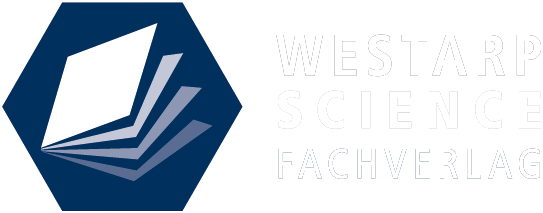Ergänzungslieferung 83
Mit der EL 83 präsentieren wir eine weitere monothematisch ausgerichtete Ergänzungslieferung (Von der Krise zur Transformation?! – Religionspädagogische Impulse für eine sich wandelnde Welt), die von unserer Facheditorin PD Dr. Maike Maria Domsel – im HdR ab jetzt zuständig für den erweiterten Bereich Religionspädagogik, interreligiöse Bildung und Katechetik – konzeptionell entwickelt und herausgeberisch betreut wurde. Dafür danken wir ihr sehr herzlich! Zugleich bedanken wir uns bei Herrn Prof. Dr. Thorsten Knauth, der bislang für den Bereich der evangelischen Religionspädagogik zuständig war, für seine Anregungen zum Gelingen des HdR.
Die HdR-Herausgeber
Von der Krise zur Transformation?! – Religionspädagogische Impulse für eine sich wandelnde Welt
Aktuell zeichnen sich besorgniserregende Entwicklungen ab: Der anhaltende Krieg in der Ukraine, der eskalierende Nahostkonflikt, Rekordtemperaturen, die zunehmende Umweltzerstörung sowie kriegs- und klimabedingte Migrationsbewegungen und wirtschaftliche Unsicherheiten prägen die weltweite Lage. Diese Krisen führen zu erheblichen Herausforderungen, die Gefühle der Unsicherheit und Bedrohung auslösen und sowohl gesellschaftliche Werte als auch den sozialen Frieden gefährden. Sie setzen einen neuen Maßstab für die Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Problemen.
Die Lebensrealitäten des 21. Jahrhunderts sind von tiefgreifenden gesellschaftlichen Umbrüchen geprägt, die einstige Gewissheiten infrage stellen und eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Herausforderungen erfordern. In diesem Kontext gewinnt der Begriff „Krise“ (altgriech. crisis) an Bedeutung, da er ursprünglich als Gelegenheit zur Beurteilung, Reflexion und Entscheidung gedacht war. Heute ist er ein zentrales Konzept für das Verstehen und Handeln in pluralen, säkularen Gegenwartsgesellschaften.
Der Umgang mit dieser krisenhaften Wirklichkeit stellt insbesondere im Bildungsbereich neue und erhebliche Anforderungen. Religionspädagogik versteht sich in diesem Kontext als Krisenwissenschaft, die darauf abzielt, in Zeiten der Unsicherheit Orientierung und Handlungsperspektiven zu bieten. Allerdings wird die gegenwärtige Krise oft als dauerhafter Zustand wahrgenommen, was die Wirksamkeit des Krisenbegriffs schwächt und das Gefühl der Machtlosigkeit, besonders unter Jugendlichen, verstärkt. Dies begünstigt vereinfachende und polarisierende politische Botschaften, während religiöse Narrative an Überzeugungskraft verlieren. Angesichts einer rückläufigen religiösen Sozialisation und der wachsenden Bedeutung empirisch-naturwissenschaftlicher Ansätze erfordert die Integration christlicher Hoffnungsnarrative im Bildungsprozess eine fundierte Kontextualisierung.
Krisen, Umbrüche und Unsicherheiten sind einerseits mit Gefahren und Bedrohungen verbunden, die Handlungsspielräume einschränken und zu vermehrten Konflikten und Polarisierungen führen. Andererseits eröffnen sie auch Räume für Kreativität, Innovation und erweiterte Handlungsmöglichkeiten, die neue Perspektiven bieten und die Gelegenheit zur Transformation etablierter gesellschaftlicher Muster schaffen können. In diesem Zustand des Übergangs stellen sich Fragen nach möglichen Gestaltungsräumen, die im Kontext der übergeordneten Frage nach einer lebenswerten Zukunft, auch für kommende Generationen, von großer Relevanz sind. Diese gewinnen auch und gerade am Lernort Schule an Bedeutung, der bekanntlich als Spiegel der Gesellschaft gilt.
Inmitten dieser komplexen Dynamik wird die Notwendigkeit, mit dem gesellschaftlichen Wandel umzugehen, besonders deutlich. Hierbei entsteht eine Spannung: Einerseits besteht die Herausforderung, bewährte Überzeugungen, Deutungen und Strategien auf die aktuelle Situation anzuwenden; andererseits verlangt die gegenwärtige Lage womöglich eine kritische Überprüfung und Anpassung dieser Denkweisen.
Vor diesem Hintergrund stellt sich auch die Frage, wie religiöse Bildung konzipiert werden kann, um christliche Hoffnungsnarrativen als Deutungsoptionen in der „Krise aus Krisen“ plausibel zu machen. Es gilt zu überlegen, ob eine veränderte Theoriebildung oder eine Neuausrichtung der Religionspädagogik notwendig ist, um zur Transformation der Krisensituation beizutragen.
In diesem Kontext wird Religionslehrkräften aufgrund ihrer kontinuierlichen Auseinandersetzung mit sinnstiftend-spirituellen und existenziellen Themen durchaus eine herausragende Kompetenz im Umgang mit Krisen zugeschrieben. Dabei können sowohl ihre persönliche als auch ihre professionelle Glaubensidentität sowie spirituelle Ressourcen als Grundlage dienen. Die Entwicklung von Persönlichkeitskompetenzen im Rahmen eines (religions)pädagogischen Habitus stellt dabei eine bedeutende Aufgabe dar. Somit entfaltet sich die Frage nach potenziellen Orientierungspunkten, die die religiöse Bildung, insbesondere der Religionsunterricht, in dieser Situation bieten kann: Inwiefern lässt sich religiöse Bildung vor dem Hintergrund unterschiedlichster krisenhafter Ereignisse und einer zutiefst erschütterten Welt (neu) konzipieren? Welch transformatives Potenzial könnte sich aus diesen Krisensituationen idealiter ergeben?
Das vorliegende Themenheft widmet sich der Frage, wie religiöse Bildung in Zeiten multipler Krisen transformative Potenziale entfalten kann. Die Beiträge reflektieren die komplexen Dynamiken und bieten Perspektiven zur Neuausrichtung der Religionspädagogik im 21. Jahrhundert: Prof. Dr. Johannes Heger (Lehrstuhl für Religionspädagogik, Universität Würzburg) beleuchtet die Bedeutung menschenrechtsbezogener religiöser Bildung als Antwort auf die Herausforderungen krisenhaften Wandels. Er argumentiert, dass ein Fokus auf Menschenrechte und Gerechtigkeit zentrale Elemente einer krisensensiblen Religionspädagogik darstellen kann. Prof. Dr. Hans Mendl (Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts, Universität Passau) hinterfragt die Grenzen der Subjektorientierung in der religiösen Bildung angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Umbrüche. Er schlägt vor, die pädagogischen Ansätze zu erweitern, um den neuen Anforderungen und dem Wandel in den Bildungslandschaften gerecht zu werden. Maurice Steffens (StR i.K. des Bistums Aachen und Promovent am Lehrstuhl für Religionspädagogik der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn) untersucht, inwiefern Krisen als Leitkonzept für religiöse Bildung dienen können. Er analysiert die Möglichkeiten, die Krisensensibilität für die Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden zu nutzen und bietet praxisnahe Impulse für einen entsprechenden Religionsunterricht. Dr. Annika Krahn (Akademische Rätin am Lehrstuhl für Religionspädagogik, Universität Bamberg) fokussiert sich auf Nachhaltigkeit als ein zentrales Handlungsprinzip in der religiösen Bildung. Sie argumentiert, dass transformatives Lernen und nachhaltige Werte integrale Bestandteile einer zukunftsfähigen religiösen Bildung sein sollten. Prof. Dr. Angela Kaupp (Professorin für Praktische Theologie, Religionspädagogik und Fachdidaktik/ Bibeldidaktik am Institut für Katholische Theologie der Universität Koblenz-Landau) diskutiert die Rolle von Schulpastoral und Schulseelsorge als resilienzfördernde Felder innerhalb der religiösen Bildung. Sie zeigt auf, wie diese Bereiche zur Unterstützung und Stärkung von Schüler*innen in Krisensituationen beitragen können. Dr. Christian Ratzke (Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Katholische Theologie im Lehr- und Forschungsgebiet Religionspädagogik, RWTH Achen) analysiert die Potenziale digitalen Lernens im Religionsunterricht als Antwort auf den disruptiven Wandel. Er bietet Einblicke, wie digitale Medien und innovative Technologien zur Bewältigung von Krisensituationen beitragen können. Prof.in Mag.a Mevlida Mešanović (Pädagogische Hochschule Augustinum Graz, Fachbereich Religion) untersucht interreligiöse Begegnungen und den interreligiösen Dialog als Schlüssel für den erfolgreichen Umgang mit Konflikten und Unsicherheiten im schulischen Kontext. Ihre Arbeit betont die Bedeutung von Dialog und Verständnis für ein harmonisches Zusammenleben. Dr. Marina Kiroudi (Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Religionspädagogik, Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Bonn) bietet orthodoxe kindertheologische Zugänge zur Krise als Chance an. Sie zeigt, wie orthodoxe Perspektiven zur Bewältigung von Krisen beitragen und den Kindern und Jugendlichen in turbulenten Zeiten Orientierung bieten können.
Maike Maria Domsel
(verantwortliche Herausgeberin der EL 83)