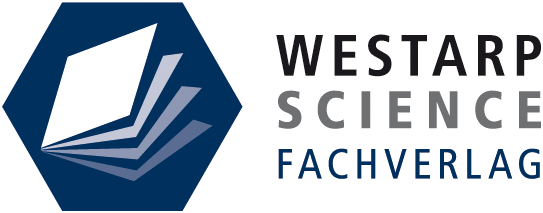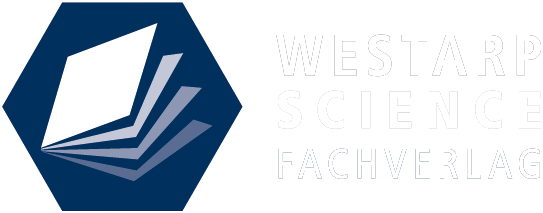Hans Mendl
Religiöse Bildung im 21. Jahrhundert: Grenzen der Subjektorientierung angesichts gesellschaftlicher Umbrüche?
Zusammenfassung und Schlagwörter
Die große Bedeutung, die das Prinzip der Subjektorientierung in der Religionspädagogik impliziert, ist vor dem Hintergrund der Befreiungsgeschichte des Subjekts seit der Aufklärungszeit zu verstehen. Mit der Konzeption eines starken Subjekts setzte man sich pädagogisch und religionspädagogisch vom kirchlich lange dominanten Modell einer Bildung ab, das auf Wissensvermittlung, Prägung und Einpassung hin angelegt war. Im Zuge der Entfaltung dieses Globalprinzips einer Subjektorientierung wurden normative Ansprüche weitgehend ausgeblendet oder gar negiert. Dies kann an vielen Modellvorstellungen aus der religionspädagogischen Theoriebildung gezeigt werden. Gleichzeitig lässt sich beobachten, dass in den letzten Jahren ‒ in ganz unterschiedlichen Schattierungen und häufig sehr rigide formuliert ‒ verschiedene Formen normativer Vorgaben in den gesellschaftlichen Diskurs eingebracht werden. Im pädagogischen Bereich wird dies am deutlichsten in den pädagogischen Konsequenzen, die vor dem Hintergrund der ökologischen Krise gezogen werden und zu stark normativ aufgeladenen Konzepten einer nachhaltigen Bildung führen. Angesichts dessen erscheint es als notwendig, einerseits über die systemischen blinden Flecken nachzudenken, die mit einer einseitigen Subjektorientierung verbunden sind, und andererseits, sie so weiterzuentwickeln und auszudifferenzieren, dass damit die massiven gesellschaftlichen Umbrüche adäquat pädagogisch angegangen werden können.
Subjektorientierung, Normativität, Bildung für nachhaltige Entwicklung, ökologische Krise, Emanzipation, Anthropozentrismus, Menschenbild
Religious education in the 21st century: The limits of subject-orientation in the face of social upheaval?
Summary and Key Words
The great importance that the principle of subject orientation implies in religious education must be understood against the background of the subject’s history of liberation since the Enlightenment period. The concept of a strong subject distanced itself pedagogically and religiously from the long dominated ecclesiastical model of education, which was aimed at imparting knowledge, shaping and fitting in. In the course of the development of this global principle of subject orientation, normative claims were largely ignored or even negated. This can be seen in many models from religious education theory formation. At the same time, it can be observed that in recent years various forms of normative requirements have been introduced into social discourse in very different shades and often very rigidly formulated. In the educational area, this is most evident in the pedagogical consequences that are drawn against the backdrops of the ecological crisis and lead to highly normatively charged concepts of sustainable education. Against this backdrop, it appears necessary, on the one hand, to think about the systemic blind spots that are associated with a one-sided subject orientation, as well as to further develop and differentiate them so that the massive social upheavals can be adequately addressed educationally.
Subject orientation, normativity, education for sustainable development, ecological crisis, emancipation, anthropocentrism, image of humanity
83. Ergänzungslieferung / 2025 / Gliederungs-Nr.: XIV – 5.1.1.5</b